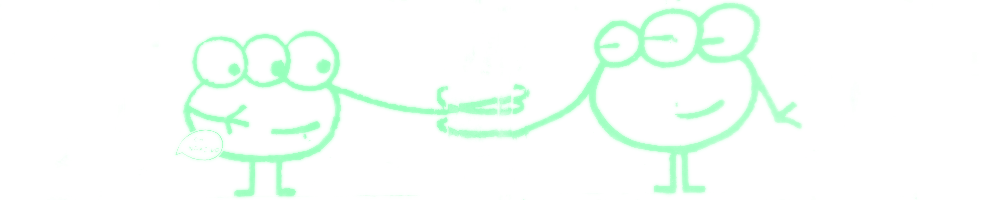Am 12.10. dürfen wir in Hamburg wieder an die Urnen treten – es finden zwei Volksentscheide statt. In dem Beitrag geht es um den “Volksentscheid Zukunft”, zum Volksentscheid Hamburg testet Grundeinkommen.
Über den Gesetzentwurf zum Zukunftsentscheid habe ich letztes Jahr ausführlich berichtet. Ich sehe keine essentielle Veränderung gegenüber dem damaligen Stand. Das Originalgesetz legt die Messlatte für die Zielerreichung sehr hoch, hat aber keine Konsequenzen beim Verfehlen. Würde man das in dieser vorgeschlagenen Form zum Gesetz werden lassen, sehe ich unkalkulierbare Folgen.
Eins können wir gewiss sein: wir werden die Jahresscheiben reißen. Es werden Gremien tagen. Es werden irgendwelche Maßnahmen beschlossen.
Was wir auch wissen: Bäume können wir zwar pflanzen, kompensieren aber rechtlich kein CO2.
Und dann kommen immer wieder Debatten um die Gasheizungen. Doch anders als beim Gebäudeenergiegesetz, wo es einen Fahrplan gibt (mit kruden Hintertüren, anderes Thema), sehe ich das hier nicht. Die nächste Jahresscheibe droht ja zu kommen.
Nun wird gerne argumentiert, dass es sinkende Heizkosten und nur moderate Sanierungskosten für die Mieter geben würde. Das einzige, wo etwas dazu geregelt ist, ist §2 Abs. 4: die Ziele sollen “sozialverträglich umzusetzen” sein – und erst nachgeordnet das Gebot der Wirtschaftlichkeit bzw. Sparsamkeit aufkommen. Das mag ein einfacher juristischer Hebel sein, der in der Anwendung viel Auslegungsbedarf haben wird. Soll die Stadt nun den Eigentümern die energetischen Maßnahmen so stark bezuschussen, dass die dann daraus resultierende Umlage auf die Miete nur noch den eingesparten Energiekosten entspricht? Glaskugel.
Ich durfte mich in diesem Jahr mit solchen Fragen für das Haus, in dem ich wohne, befassen. Und bei kaum einer Baumaßnahme werde ich monetär die Amortisation überleben – selbst mit den aktuellen Fördermitteln. Ob das Haus es überlebt – keine Ahnung. Aber selbst wenn man alles umsetzen würde, was derzeit der Energieberater vorschlägt, wäre das trotzdem nur eine Ersparnis von 60%. Da bin ich ahnungslos, wie ich meinen Beitrag dazu liefern kann.
Und fernab der Realität sagt dann der Mietervereinchef Rolf Bosse
Weil irgendwann alle anfangen, ihre Gebäude zu sanieren. Weil irgendwann alle die Fachkräfte suchen. Der Markt wird leer gefegt sein. Wir müssen jetzt die Kapazitäten aufbauen, dann klappt es.
Ich glaube, er hat schon lange keinen Klempner mehr gesucht.
Alle damals gestellten Sorgen sehe ich nach wie vor (siehe eben alten Beitrag). Hier fokussiere ich mich auf die Abstimmungsbroschüre. In dieser darf die Initiative und die im Parlament vertretenen Parteien gleichermaßen Stellung beziehen – die Fraktionen im Anteil entsprechend ihrer Stärke.
Initiative
Zur Seite der Inititative. Mich triggern vor allem die Vorteile (im PDF auf Seite 4). Ohne Frage, die klingen erst einmal gut, nehmen wir den Abschnitt des “Verbesserten Verkehrs”:
- Klimaschutz braucht gut ausgebauten Nahverkehr – für alle erreichbar
- Besserer ÖPNV heißt: weniger Lärm, saubere Luft und entspannt ans Ziel
- Weniger Stau und keine Verbote für Autos
Die Sätze würde ich als Ziele allesamt unterstreichen. Und wären auch gute Maßnahmen, die man ins Gesetz hätte schreiben sollen. Aber das ist eben nicht geregelt. Angenommen das Gremium sagt: Wir bauen eine Straßenbahn, damit mehr Menschen das Auto stehen lassen und wir da CO2 einsparen. Oder anders: Kiel hat diese die Weichen für eine Tram weitestgehend gestellt – und wenn alles gut läuft, werden die ersten Abschnitte 2034, also in 9 Jahren, in Betrieb gehen. Neun Jahre, in dem wir zum normalen CO2 noch Bau-CO2 für die Tram haben werden. Also neun Jahre, in dem wir durch die Maßnahme keine Erfolge sehen werden und weitere Jahresziele verfehlen.
Und so zieht sich das auch eben beim schon thematisierten Wohnen weiter.
Kommen wir zur anderen Seite, wie positionieren sich die Parteien der Bürgerschaft ?
SPD/Grüne
Die Regierung ist sich offenbar einig, dass all das, was sie derzeit tun, schon sinnvoll ist. Sie betonen u.a. dass sie 2020 einen “verbindlichen Klimaplan” beschlossen hätten. Wie merkbefreit muss man denn als Grüner sein, diese vage Absichtserklärung in Gesetzesform so zu betiteln, wo die Initiative gerade zu diese Unverbindlichkeit anprangert?
Im Grunde genommen nehmen sie die Forderungen der Initiative gar nicht ernst. Zwischen den Zeilen gelesen votieren sie für den Volksentscheid.
CDU
Anders als das Gelaber von SPD/Grüne gibt die CDU kontra – und deren Punkte kann ich nachvollziehen. Aber sie zeigen keinen Plan, wie sie es stattdessen lösen wollen. Sie verstecken sich hinter Nebenwolken wie “technologischer Fortschritt” und “nach Augenmaß”.
Sie würden schon allein die tramophobe SPD richtig ordentlich dissen, wenn sie noch das Wort “Straßenbahn” in ihr Statement eingebaut hätten.
Linke
Die Linke votiert – welch Überraschung – für den Entscheid. Und bringt noch viele andere Ideen rein, wie das Ausrufen des Klimanotstandes (keine Ahnung, was das heißt) und sieht den Entscheid nur als Grundlage.
Braune
Die Braunen drehen die Fakten um, allein dass die anvisierten erneuerbaren Energien als “teure Energien” hinstellen.
Fazit
Ohne Zweifel müssen wir mehr Aktivitäten zeigen, die CO2 reduziert, allem voran vermeidbares CO2.
Ich würde gerne das bestehende Gesetz an anderen Stellen erweitern und verschärfen. Im Grunde genommen liefert die Abstimmungsbroschüre an vielen Stellen Futter, wie bspw. Verkehr, Gebäudesektor, erneuerbare Energien, etc. Und vor allem auch die Kompensation, also Begrünung, stärken. Und da hilft uns nicht, das halbgare Klimagesetz mit wackeligen Fundament, in dieser Form zu verschärfen.